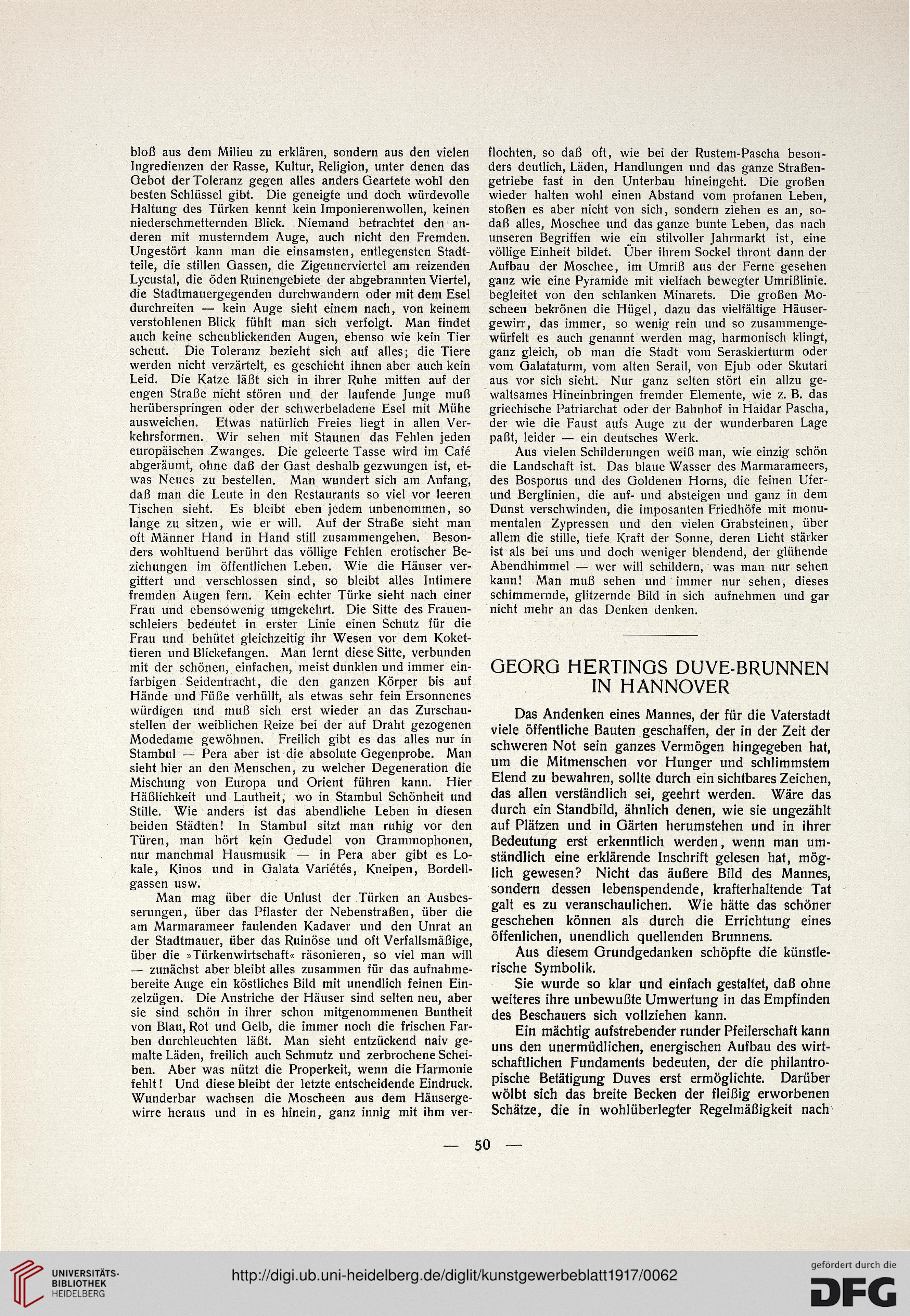bloß aus dem Milieu zu erklären, sondern aus den vielen
Ingredienzen der Rasse, Kultur, Religion, unter denen das
Gebot der Toleranz gegen alles anders Geartete wohl den
besten Schlüssel gibt. Die geneigte und doch würdevolle
Haltung des Türken kennt kein Imponierenwollen, keinen
niederschmetternden Blick. Niemand betrachtet den an-
deren mit musterndem Auge, auch nicht den Fremden.
Ungestört kann man die einsamsten, entlegensten Stadt-
teile, die stillen Gassen, die Zigeunerviertel am reizenden
Lycustal, die öden Ruinengebiete der abgebrannten Viertel,
die Stadtmauergegenden durchwandern oder mit dem Esel
durchreiten — kein Auge sieht einem nach, von keinem
verstohlenen Blick fühlt man sich verfolgt. Man findet
auch keine scheublickenden Augen, ebenso wie kein Tier
scheut. Die Toleranz bezieht sich auf alles; die Tiere
werden nicht verzärtelt, es geschieht ihnen aber auch kein
Leid. Die Katze läßt sich in ihrer Ruhe mitten auf der
engen Straße nicht stören und der laufende Junge muß
herüberspringen oder der schwerbeladene Esel mit Mühe
ausweichen. Etwas natürlich Freies liegt in allen Ver-
kehrsformen. Wir sehen mit Staunen das Fehlen jeden
europäischen Zwanges. Die geleerte Tasse wird im Cafe
abgeräumt, ohne daß der Gast deshalb gezwungen ist, et-
was Neues zu bestellen. Man wundert sich am Anfang,
daß man die Leute in den Restaurants so viel vor leeren
Tischen sieht. Es bleibt eben jedem unbenommen, so
lange zu sitzen, wie er will. Auf der Straße sieht man
oft Männer Hand in Hand still zusammengehen. Beson-
ders wohltuend berührt das völlige Fehlen erotischer Be-
ziehungen im öffentlichen Leben. Wie die Häuser ver-
gittert und verschlossen sind, so bleibt alles Intimere
fremden Augen fern. Kein echter Türke sieht nach einer
Frau und ebensowenig umgekehrt. Die Sitte des Frauen-
schleiers bedeutet in erster Linie einen Schutz für die
Frau und behütet gleichzeitig ihr Wesen vor dem Koket-
tieren und Blickefangen. Man lernt diese Sitte, verbunden
mit der schönen, einfachen, meist dunklen und immer ein-
farbigen Seidentracht, die den ganzen Körper bis auf
Hände und Füße verhüllt, als etwas sehr fein Ersonnenes
würdigen und muß sich erst wieder an das Zurschau-
stellen der weiblichen Reize bei der auf Draht gezogenen
Modedame gewöhnen. Freilich gibt es das alles nur in
Stambul — Pera aber ist die absolute Gegenprobe. Man
sieht hier an den Menschen, zu welcher Degeneration die
Mischung von Europa und Orient führen kann. Hier
Häßlichkeit und Lautheit, wo in Stambul Schönheit und
Stille. Wie anders ist das abendliche Leben in diesen
beiden Städten! In Stambul sitzt man ruhig vor den
Türen, man hört kein Gedudel von Grammophonen,
nur manchmal Hausmusik — in Pera aber gibt es Lo-
kale, Kinos und in Galata Varietes, Kneipen, Bordell-
gassen usw.
Man mag über die Unlust der Türken an Ausbes-
serungen, über das Pflaster der Nebenstraßen, über die
am Marmarameer faulenden Kadaver und den Unrat an
der Stadtmauer, über das Ruinöse und oft Verfallsmäßige,
über die »Türkenwirtschaft« räsonieren, so viel man will
— zunächst aber bleibt alles zusammen für das aufnahme-
bereite Auge ein köstliches Bild mit unendlich feinen Ein-
zelzügen. Die Anstriche der Häuser sind selten neu, aber
sie sind schön in ihrer schon mitgenommenen Buntheit
von Blau, Rot und Gelb, die immer noch die frischen Far-
ben durchleuchten läßt. Man sieht entzückend naiv ge-
malte Läden, freilich auch Schmutz und zerbrochene Schei-
ben. Aber was nützt die Properkeit, wenn die Harmonie
fehlt! Und diese bleibt der letzte entscheidende Eindruck.
Wunderbar wachsen die Moscheen aus dem Häuserge-
wirre heraus und in es hinein, ganz innig mit ihm ver-
flochten, so daß oft, wie bei der Rustem-Pascha beson-
ders deutlich, Läden, Handlungen und das ganze Straßen-
getriebe fast in den Unterbau hineingeht. Die großen
wieder halten wohl einen Abstand vom profanen Leben,
stoßen es aber nicht von sich, sondern ziehen es an, so-
daß alles, Moschee und das ganze bunte Leben, das nach
unseren Begriffen wie ein stilvoller Jahrmarkt ist, eine
völlige Einheit bildet. Über ihrem Sockel thront dann der
Aufbau der Moschee, im Umriß aus der Ferne gesehen
ganz wie eine Pyramide mit vielfach bewegter Umrißlinie,
begleitet von den schlanken Minarets. Die großen Mo-
scheen bekrönen die Hügel, dazu das vielfältige Häuser-
gewirr, das immer, so wenig rein und so zusammenge-
würfelt es auch genannt werden mag, harmonisch klingt,
ganz gleich, ob man die Stadt vom Seraskierturm oder
vom Galataturm, vom alten Serail, von Ejub oder Skutari
aus vor sich sieht. Nur ganz selten stört ein allzu ge-
waltsames Hineinbringen fremder Elemente, wie z. B. das
griechische Patriarchat oder der Bahnhof in Haidar Pascha,
der wie die Faust aufs Auge zu der wunderbaren Lage
paßt, leider — ein deutsches Werk.
Aus vielen Schilderungen weiß man, wie einzig schön
die Landschaft ist. Das blaue Wasser des Marmarameers,
des Bosporus und des Goldenen Horns, die feinen Ufer-
und Berglinien, die auf- und absteigen und ganz in dem
Dunst verschwinden, die imposanten Friedhöfe mit monu-
mentalen Zypressen und den vielen Grabsteinen, über
allem die stille, tiefe Kraft der Sonne, deren Licht stärker
ist als bei uns und doch weniger blendend, der glühende
Abendhimmel — wer will schildern, was man nur sehen
kann! Man muß sehen und immer nur sehen, dieses
schimmernde, glitzernde Bild in sich aufnehmen und gar
nicht mehr an das Denken denken.
GEORG HERTINGS DUVE-BRUNNEN
IN HANNOVER
Das Andenken eines Mannes, der für die Vaterstadt
viele öffentliche Bauten geschaffen, der in der Zeit der
schweren Not sein ganzes Vermögen hingegeben hat,
um die Mitmenschen vor Hunger und schlimmstem
Elend zu bewahren, sollte durch ein sichtbares Zeichen,
das allen verständlich sei, geehrt werden. Wäre das
durch ein Standbild, ähnlich denen, wie sie ungezählt
auf Plätzen und in Gärten herumstehen und in ihrer
Bedeutung erst erkenntlich werden, wenn man um-
ständlich eine erklärende Inschrift gelesen hat, mög-
lich gewesen? Nicht das äußere Bild des Mannes,
sondern dessen lebenspendende, krafterhaltende Tat
galt es zu veranschaulichen. Wie hätte das schöner
geschehen können als durch die Errichtung eines
öffenlichen, unendlich quellenden Brunnens.
Aus diesem Grundgedanken schöpfte die künstle-
rische Symbolik.
Sie wurde so klar und einfach gestaltet, daß ohne
weiteres ihre unbewußte Umwertung in das Empfinden
des Beschauers sich vollziehen kann.
Ein mächtig aufstrebender runder Pfeilerschaft kann
uns den unermüdlichen, energischen Aufbau des wirt-
schaftlichen Fundaments bedeuten, der die philantro-
pische Betätigung Duves erst ermöglichte. Darüber
wölbt sich das breite Becken der fleißig erworbenen
Schätze, die in wohlüberlegter Regelmäßigkeit nach
— 50 —